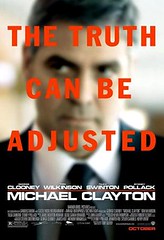 “Aus George Clooney ist ein Schauspieler geworden!” Das war meine erste Reaktion auf Michael Clayton, das mehrfach für den Oscar nominierte Regiedebüt von Tony Gilroy, der u.a. die Drehbücher der Bourne-Filme geliefert hat.
“Aus George Clooney ist ein Schauspieler geworden!” Das war meine erste Reaktion auf Michael Clayton, das mehrfach für den Oscar nominierte Regiedebüt von Tony Gilroy, der u.a. die Drehbücher der Bourne-Filme geliefert hat.
Als treuer Emergency Room-Zuschauer war mir der Charme des Herrn Clooney geläufig gewesen, doch bisher hatten sich seine überzeugenden Rollen auf (Gauner-)Komödien á la Out of Sight und Ein Unmöglicher Härtefall beschränkt.
Mit Cary Grant und Clark Gable wurde er nicht zuletzt auf Basis dieser Filme in Verbindung gebracht. Sein Spiel scheint gerade von Grants Screwball-Komödien und dessen späte Rollen, wie neben Audrey Hepburn in Charade, geprägt zu sein. Entspannte Womanizer im feinen Zwirn, die durch ihre Selbstironie die Herzen der weiblichen Hauptfiguren und hingerissenen Zuschauerinnen im Sturm gewinnen.
Die größten Rollen von Cary Grant waren untrennbar mit seinem Starimage verbunden, man fordert es noch heute beim Ansehen seiner Filme geradezu ein. Ein Cary Grant-Film wird nicht auf dieselbe Weise geschaut, wie ein Robert DeNiro-Film. Man will das eigene Bild von Cary Grant wieder und wieder in Variationen bestätigt sehen, nicht den detailgenauen Method Actor, der hinter seiner Figur verschwindet. Dank Grants komödiantischem Vermögen bleibt das auch interessant, egal wie viele seiner Filme man nun sieht.
Clooney hätte sich eine veritable Karriere auf ähnliche Weise aufbauen können, doch schon einer seiner “frühen” großen Kinofilme, Robert Rodriguez‘ Roadmovie-Vampir-Slasher From Dusk Till Dawn, bewies seinen Hang zu Filmen abseits ausgetretener Blockbusterpfade. Mit den eigenen Regiearbeiten (Confessions of a Dangerous Mind, Good Night and Good Luck) und seiner Zusammenarbeit mit Steven Soderbergh bestätigte er diese Tendenz auch im neuen Jahrtausend. Hinter der Kamera hatte er so sein – für viele überraschendes – Können bewiesen. Dass er auch vor der Kamera souverän als Schauspieler – nicht Star – agieren kann, hätte zumindest ich nicht gedacht. Soviel zur Lobdudelei im voraus.
Michael Clayton ist ein Anwaltsthriller. Das ist ein ausglutschtes Genre, denkt man. Bitte nicht noch eine Grisham-Verfilmung/Kopie, denkt man. Gute Einwände gegen weitere Leinwandabenteuer im Gerichtssaal gibt es zuhauf, sie alle haben ihre Berechtigung. Tony Gilroy jedenfalls tat einen ersten lobenswerten Schritt, indem er einen Film über Anwälte gedreht hat, der ohne einen Gerichtssaal auskommt. Regisseur und Autor Gilroy hat einen zweiten, vorteilhaften Schritt dadurch unternommen, dass er seine Erzählung nicht auf das Ankurbeln des Plots beschränkt.
Wie will man sonst die Existenzberechtigung einer Sequenz erklären, in der Karen Crowder (Tilda Swinton) vor dem Spiegel steht, um wieder und wieder die vorbereiteten Sätze für ein Fernsehinterview von sich zu geben? Sie ist eine Perfektionistin, sagen uns die Bilder. Sie ist unsicher, nervös und würde wohl alles dafür tun, ihre Karriere in Gang zu halten. Der Film baut einige solcher zeitlichen Nullpunkte ein, um seine Figuren und die verkommene, urbane Geschäftswelt, in der sie leben, näher zu beleuchten.
Angefangen bei den Monologen des verrückt gewordenen Staranwalts Arthur Edens (Tom Wilkinson), der in seinem Wahn die amoralische, dunkle Seite seiner Profession durchschaut, bis hin zur Schilderung der privaten Katastrophen des Ausputzers Michael Clayton (Clooney) selbst, verfolgt Gilroy in der ersten Hälfte des Films, um es übertrieben auszudrücken, die Schilderung der Krankheit Zivilisation. Deren schlimmste Auswüchse scheinen die großen Anwaltskanzleien zu sein, die Milllionen mit der Verteidigung über Leichen gehender Chemiekonzerne verdienen. Einzig die Natur und die Geborgenheit des Familienverbandes scheinen den geplagten Großstädter Clayton die Freiheit verheißen zu können.
Denn er ist am Ende, ist ausgebrannt, müde, durch seinen Job, in dem er reiche Klienten als juristischer Expressdienst in den ersten Minuten nach ihrem Vergehen berät, sie vor dem Gefängnis bewahrt. Vom Glamour des Danny Ocean sieht man in Clooneys Spiel nichts. Der ehemals Spielsüchtige (was für eine Ironie im Hinblick auf die Filmografie des Hauptdarstellers!) scheint sich in einem aus Glas und Stahlbeton bestehendem Gefängnis zu befinden. Erst als sein Freund Arthur sich während einer Vorverhandlung vor aller Augen nackt auszieht, damit die Verteidigung des Chemiegiganten U-North in Gefahr bringt und Clayton die Kohlen aus dem Feuer holen soll, keimt der Zweifel an seiner Profession gemächlich in ihm auf.
Der Verdienst des Drehbuchs ist die ausgeklügelte Figurenzeichnung, die Clayton nicht zum Heiligen ausstaffiert und Swintons Figur (eine U-North-Anwältin) nicht zur alles kontrollierenden Antagonistin. Für Zuschauer, die einen konventionellen Thriller erwarten, könnte das in ein paar Längen resultieren, doch Gilroy weiß durch so manchen Schock zu überraschen. Oft schlägt hierbei weniger der Plot die Haken, stattdessen geht die Inszenierung Wege, die man als Kenner des Genres schlicht und einfach nicht antizipiert. Selbst das etwas formelhafte Ende wird uns glaubhaft verkauft, weil der Film nie die Entwicklung seiner in der Grauzone der Moral agierenden Figuren vernachlässigt und eine der befriedigensten letzten Einstellungen des Jahres enthält.
Als ein weiteres großes Glück muss man die Tatsache betrachten, dass Tony Gilroy sich in seinem Debüt nicht an der Handkamera-Ästhetik der Bourne-Regisseure orientiert hat. Michael Clayton ist mehr The Insider, mehr Michael Mann oder Sidney Pollack (der auch mitspielt), als Paul Greengrass und erbringt den Beweis, das ein Realismuseffekt auch ohne die intensified continuity, wie David Bordwell den Trend bezeichnet, zu erreichen ist.
Michael Clayton war der Oscar-Film mit den meisten Schauspieler-Nominierungen (insgesamt drei), was nicht unbegründet geschah. Die ausgeglichenen Leistungen des Ensembles, in dem ein Clooney auch nicht gegenüber der großartigen Swinton verblasst, machen den Anwaltsthriller am Ende zu einem überzeugenderen Beitrag als das unter seine angestrebte Größe zu ersticken drohende Ölepos There Will Be Blood.

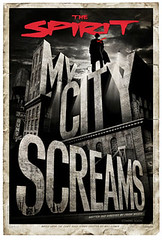 Man könnte glauben Graphic Novel Maestro Frank Miller (300) würde sich für seine zweite Regiearbeit nach Sin City wieder ein eigenes Comic als Vorlage nehmen. Doch falsch gedacht!
Man könnte glauben Graphic Novel Maestro Frank Miller (300) würde sich für seine zweite Regiearbeit nach Sin City wieder ein eigenes Comic als Vorlage nehmen. Doch falsch gedacht! 
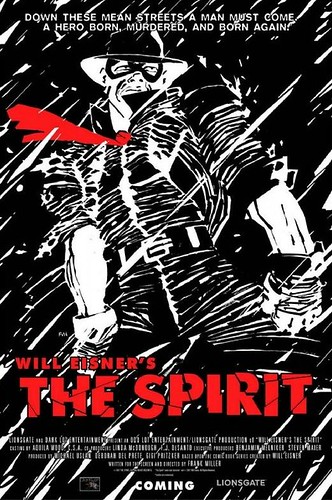






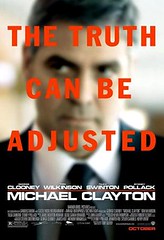 “Aus George Clooney ist ein Schauspieler geworden!” Das war meine erste Reaktion auf
“Aus George Clooney ist ein Schauspieler geworden!” Das war meine erste Reaktion auf  Klirrende Streicher, als stoße jeder einzelne Sonnenstrahl seinen langgezogenen Klagelaut aus, während er sich in den Nacken dreckverschmierter Arbeiter einbrennt. Die karge Wüstenlandschaft mit ihren welligen Hügeln. Einer Mondlandschaft gleich verbieten ihre trockenen Steine jedes menschliche Leben.
Klirrende Streicher, als stoße jeder einzelne Sonnenstrahl seinen langgezogenen Klagelaut aus, während er sich in den Nacken dreckverschmierter Arbeiter einbrennt. Die karge Wüstenlandschaft mit ihren welligen Hügeln. Einer Mondlandschaft gleich verbieten ihre trockenen Steine jedes menschliche Leben.