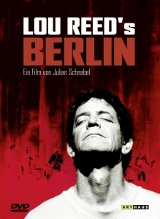Als Jeffrey Hyman eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich auf einer Bühne zu einem riesigen Rockstar verwandelt wieder…
Als Jeffrey Hyman eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich auf einer Bühne zu einem riesigen Rockstar verwandelt wieder…
Als ich gestern früh aus unruhigen Träumen erwachte, wusste ich noch nicht, dass ich am Nachmittag in den Müller gehen würde, um das Angebot von 5 Filmen zum Preis von 4 zu nutzen. Oder vielleicht doch? Auf jeden Fall wusste ich nicht, dass ich am gleichen Abend “Dark Star”, das Erstlingswerk von John Carpenter sehen würde. Ich wusste auch noch nicht, dass mich ein herrlicher, wirklich wunderbarer Science-Fiction-Trash mit philosophischem Tiefgang erwarten würde… und später ein furchtbarer Wutanfall wegen des temporären Durchdrehens meines Computers…
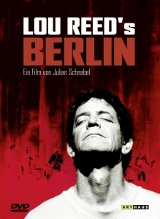 Als ich heute morgen aus unruhigen Träumen erwachte, wusste ich auch noch nicht, dass ich heute Abend “End of the Century: The Story of the Ramones” gucken würde. Tatsächlich… denn außer “Dark Star” habe ich gestern ja noch vier andere Filme gekauft, die nicht “End of the Century” sind! Beim Frühstück habe ich jedoch wehmütig, wie auch zornig und ungehalten über Musik-Dokus und Konzert-Filme nachgedacht. Dabei bin ich zum Schluss gekommen, dass auch Dokus durchaus einiges an kinematografischer Handwerkskunst brauchen, um ansehnlich zu sein… dass Martin Scorsese ein ganz großartiger Dokumentar-Regisseur ist, was er nicht nur mit “Il mio viaggio in Italia”, sondern auch mit “No Direction Home” bewiesen hat; wenngleich Shine a Light micht ehrlich gesagt nicht so vom Hocker gehauen hat! Und dass “Ostpunk. Too much future” ein absolut grauenhaft schlechter, beschissener Film war, der einfach nur zum Kotzen war!!! Ein Film, der bewies, dass Dokumentationen wirklich eine gute Regie verdient haben bzw. in diesem Falle verdienen würden… Aber welche Musikdoku war wirklich gut? Wie gesagt: No Direction Home hat mich auch als jemand überzeugt, der Bob Dylan allgemein für überschätzt hält. Lou Reed‘s Berlin von Julian Schnabel war prätentiös: eine schlechte Aufführung des berühmt-berüchtigten Meisterwerks mit einem Lou Reed, der sich überhaupt keine Mühe gemacht hat, zu singen, begleitet von einem etwas dürftigen Ensemble und untermalt mit pseudo-intellektuellen Re-Enactment-Pseudo-Flashbacks. “Woodstock” war im großen und ganzen vielleicht etwas zu lang, die Splitscreens waren völlig unnötig. Bleiben also zwei Filme, die wirklich super waren: “Message to Love: The Isle of Wight Festival” (man beachte den Typen mit der Irokesen-Frisur, 1970!!!) und “Gimme Shelter”.
Als ich heute morgen aus unruhigen Träumen erwachte, wusste ich auch noch nicht, dass ich heute Abend “End of the Century: The Story of the Ramones” gucken würde. Tatsächlich… denn außer “Dark Star” habe ich gestern ja noch vier andere Filme gekauft, die nicht “End of the Century” sind! Beim Frühstück habe ich jedoch wehmütig, wie auch zornig und ungehalten über Musik-Dokus und Konzert-Filme nachgedacht. Dabei bin ich zum Schluss gekommen, dass auch Dokus durchaus einiges an kinematografischer Handwerkskunst brauchen, um ansehnlich zu sein… dass Martin Scorsese ein ganz großartiger Dokumentar-Regisseur ist, was er nicht nur mit “Il mio viaggio in Italia”, sondern auch mit “No Direction Home” bewiesen hat; wenngleich Shine a Light micht ehrlich gesagt nicht so vom Hocker gehauen hat! Und dass “Ostpunk. Too much future” ein absolut grauenhaft schlechter, beschissener Film war, der einfach nur zum Kotzen war!!! Ein Film, der bewies, dass Dokumentationen wirklich eine gute Regie verdient haben bzw. in diesem Falle verdienen würden… Aber welche Musikdoku war wirklich gut? Wie gesagt: No Direction Home hat mich auch als jemand überzeugt, der Bob Dylan allgemein für überschätzt hält. Lou Reed‘s Berlin von Julian Schnabel war prätentiös: eine schlechte Aufführung des berühmt-berüchtigten Meisterwerks mit einem Lou Reed, der sich überhaupt keine Mühe gemacht hat, zu singen, begleitet von einem etwas dürftigen Ensemble und untermalt mit pseudo-intellektuellen Re-Enactment-Pseudo-Flashbacks. “Woodstock” war im großen und ganzen vielleicht etwas zu lang, die Splitscreens waren völlig unnötig. Bleiben also zwei Filme, die wirklich super waren: “Message to Love: The Isle of Wight Festival” (man beachte den Typen mit der Irokesen-Frisur, 1970!!!) und “Gimme Shelter”.
 Also dachte ich, sollte ich heute Abend mal die aktuelle Ramones-Doku End of the Century: The Story of the Ramones gucken… gesagt getan… Und was ist passiert? Ich wurde mit schönen Bildern und Video-Ausschnitten, einigen interessanten Informationen, einigen verrückten „Doku-Flashback-Experimenten“ belohnt, aber zugleich auch mit einer ziemlichen Mittelmäßigkeit bestraft! Im Kino hätte ich sicherlich nicht mit faulen Tomaten nach der Leinwand geworfen, aber ich hätte mich sicher gefragt, ob es die fünf Euro wirklich wert war. Ein bisschen wie Nico-Icon, die Doku über Nico, die ich im Ami im Frühling 2008 sah, oder die Doku über Joy Division im Jahre 2009: beide enthielten interessante Informationen, einige schöne Bilder, aber auch viel zu lange Interview-Sequenzen… und irgendwelche sinnlosen Stadtlandschafts-Sequenzen, die verrieten, dass die Filmemacher nicht wussten, was sie eigentlich wollten. Das gleiche mit dem Ramones-Film.
Also dachte ich, sollte ich heute Abend mal die aktuelle Ramones-Doku End of the Century: The Story of the Ramones gucken… gesagt getan… Und was ist passiert? Ich wurde mit schönen Bildern und Video-Ausschnitten, einigen interessanten Informationen, einigen verrückten „Doku-Flashback-Experimenten“ belohnt, aber zugleich auch mit einer ziemlichen Mittelmäßigkeit bestraft! Im Kino hätte ich sicherlich nicht mit faulen Tomaten nach der Leinwand geworfen, aber ich hätte mich sicher gefragt, ob es die fünf Euro wirklich wert war. Ein bisschen wie Nico-Icon, die Doku über Nico, die ich im Ami im Frühling 2008 sah, oder die Doku über Joy Division im Jahre 2009: beide enthielten interessante Informationen, einige schöne Bilder, aber auch viel zu lange Interview-Sequenzen… und irgendwelche sinnlosen Stadtlandschafts-Sequenzen, die verrieten, dass die Filmemacher nicht wussten, was sie eigentlich wollten. Das gleiche mit dem Ramones-Film.
Interessante Fakten: der eigentliche Grund der Annäherung der Herren Jeffrey, Johnny, Douglas und Thomas war ihre gemeinsame Begeisterung für die Stooges. In Forest Hills, Queens, war man wohl Ende der 60er Jahre als Stooges-Fan ein Außenseiter und musste deshalb mit anderen Außenseitern zusammenhalten. Von da an wurden sie Fans der New York Dolls, und begannen als eine Art Dolls-Nachahmung in Form einer Glam-Rock-Band. Dass Alan Vega von Suicide die Ramones als erster Musiker-Kollege lobte, wusste ich ebenfalls nicht. Dass die Ramones wie eine gestörte Familie funktionierten, weiss jeder… die Anekdoten über Johnny, der Dee Dee schlug wenn dieser schlecht Bass gespielt hatte und über Dee Dee, der Johnny wegen irgendeiner Kleinigkeit mit dem Messer bedrohte, illustrieren dies eindrücklich.
Durchaus gelungen vermittelte die Doku auch den Fakt, dass die Ramones immer kommerzielle Außenseiter blieben und permanent gezwungen waren, zu touren, um zu überleben. Und anscheinend auch zum Teil vom “T-Shirt-Geld” abhängig waren, wovon der dritte Schlagzeuger Richie aber nichts sah. Der kommerzielle Misserfolg der Ramones führte dazu, dass sie sogar auf die Sex Pistols neidisch waren, die mit mehr Erfolg durch die Staaten tourten. Interessant zu bemerken war für mich, dass Dee Dee Ramone in seinen etwas Drogen- und/oder Alkohol-benebelten Interviews ein bisschen einem meiner früheren Nachbarn.
Anders gesagt: End of Century: The Story of the Ramones rangiert im glanzlosen Mittelfeld mittelmäßiger Musik-Dokus. Haut einem nicht vom Hocker, ist aber auch nicht wirklich grottenschlecht. Klassisches Problem wie bei sehr vielen solchen Dokus: die interessanten Anfänge werden überbetont, dann verliert sich das ganze Narrativ immer mehr. Das bedeutet, dass der Film nach zwei Dritteln die Puste verliert.
 Ich bin kein Filmemacher. Ich bin kein Filmexperte. Aber irgendwie könnte man die filmischen Annäherungen an Musik doch ein bisschen besser veranstalten. Die paar positiven Beispiele gelungener Musik-Dokus bzw. Konzertfilme haben vielleicht eines gemeinsam: ihr Thema ist sehr begrenzt. No Direction Home hat trotz seiner 200 Minuten nicht den Anspruch, den ganzen, kompletten Bob Dylan darzustellen, sondern bricht mit dem kontroversen Übergang zur „elektrischen Phase“ und dem mehrmonatigen Rückzug Dylans 1966 ab. Bei Message to Love: The Isle of Wight Festival geht es um gerade mal drei Tage, die aber sehr kompakt und spannend zusammengehalten werden durch Konzert-Ausschnitte und manchmal sehr lustigen Interviews beim Festival selbst. Gimme Shelter dokumentiert schlicht und einfach nur die erste USA-Tour der Rolling Stones, die in einer absoluten Katastrophe endete. Durch seine Zeitnähe besteht der Film nur aus „zeitgenössischem“ Material, wodurch die Dynamik des Films eben nicht ständig unterbrochen wird durch irgendwelche nichtssagenden Interviews mit irgendwelchen Leuten die fälschlicherweise denken, sie hätten was interessantes zu sagen. Eine thematische Eingrenzung scheint also durchaus sinnvoll zu sein bei solchen Musik-Dokus.
Ich bin kein Filmemacher. Ich bin kein Filmexperte. Aber irgendwie könnte man die filmischen Annäherungen an Musik doch ein bisschen besser veranstalten. Die paar positiven Beispiele gelungener Musik-Dokus bzw. Konzertfilme haben vielleicht eines gemeinsam: ihr Thema ist sehr begrenzt. No Direction Home hat trotz seiner 200 Minuten nicht den Anspruch, den ganzen, kompletten Bob Dylan darzustellen, sondern bricht mit dem kontroversen Übergang zur „elektrischen Phase“ und dem mehrmonatigen Rückzug Dylans 1966 ab. Bei Message to Love: The Isle of Wight Festival geht es um gerade mal drei Tage, die aber sehr kompakt und spannend zusammengehalten werden durch Konzert-Ausschnitte und manchmal sehr lustigen Interviews beim Festival selbst. Gimme Shelter dokumentiert schlicht und einfach nur die erste USA-Tour der Rolling Stones, die in einer absoluten Katastrophe endete. Durch seine Zeitnähe besteht der Film nur aus „zeitgenössischem“ Material, wodurch die Dynamik des Films eben nicht ständig unterbrochen wird durch irgendwelche nichtssagenden Interviews mit irgendwelchen Leuten die fälschlicherweise denken, sie hätten was interessantes zu sagen. Eine thematische Eingrenzung scheint also durchaus sinnvoll zu sein bei solchen Musik-Dokus.
Als Historiker würde ich wahrscheinlich irgendetwas von Fragestellung brabbeln. Keine Ahnung… 2Die Anfänge der Ramones im CBGB‘s” oder so was in der Art… oder vielleicht nur die Entstehungsgeschichte des Debütalbums beleuchten! Oder vielleicht eine Einbettung der Ramones in eine jüdisch-amerikanische Kulturgeschichte der Nachkriegszeit (ich habe da natürlich das zentrale Kapitel über die Ramones in Steven Lee Beebers wunderbarem Buch über die jüdisch-amerikanischen Wurzeln des Punkrock im Hinterkopf). Womit ich zu meinem Anfangsgedanken zurückkomme: Ich werde wahrscheinlich heute Nacht wieder unruhige Träume haben und zwar über schlechte und mittelmäßige Musik-Dokus. Letztendlich tun die mittelmäßigen, wie eben “End of Century”, mehr weh: sie machen keinen wirklich großen Spaß, aber man kann sie eben auch nicht genüsslich herunterputzen.