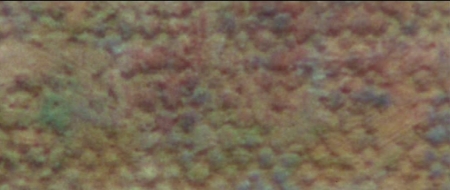Im Gegensatz zu vielen Kollegen hat Johnnie To dem sicherlich vorhandenen Ruf Hollywoods weitgehend widerstanden. Seine Filme seien untrennbar mit Hongkong verbunden, hat er in Interviews geäußert. Wohl deshalb wurde der Handlungsort des nun auf Eis liegenden Remakes des Melville-Klassikers “Le Cercle Rouge” in seine Heimatstadt verlegt. Mehrere Jahre lang wurden Liam Neeson und Orlando Bloom mit diesem Projekt in Verbindung gebracht, doch 2009 verkündete To in Cannes, dass wohl nichts aus diesem Traum werden würde. Den vermeintlichen Ersatz desselben stellte er damals vor, eine chinesisch-französische Koproduktion mit dem Namen Vengeance. Man kann To sicher nicht vorhalten, dass er immer nur den selben Film dreht. Vielmehr jongliert er eine Reihe von Serien mit jeweils unterschiedlichen thematischen und strukturellen Eigenheiten. Da sind diverse Filme mit psychisch/physisch kranken Helden, den “Fulltime Killers” und “Mad Detectives” seiner Filmografie. Dem gegenüber steht u.a. die Hitmen-Trilogie, welche 1999 mit “The Mission” in Gang gesetzt, 2006 in Gestalt von “Exiled” wiederbelebt wurde. Im Gepäck eine begrenzte Zahl visueller und narrativer Topoi, nähert sich To diesen Filmen wie einem spaßigen Genrespielplatz an. Ob ironische Entblößung der Heroic Bloodshed-Klischees durch die Inszenierung des absoluten Gegenteils derselben in “The Mission” oder Adaption und Perfektion dieser im Nachfolger, die Filme zeigen To von seiner selbstreflexivsten Seite. Nur so wird aus einem Actionfilm aus HK ein Italo-Western in asiatischem Gewand. Oder eine blutige Hommage an Jean-Pierre Melville. Als solche kann man “Vengeance” zweifellos bezeichnen. Kein Wunder, dass ursprünglich Alain Delon für die Hauptrolle vorgehesen war. Die trägt den Namen Francis Costello und scheint entfernt mit dem eiskalten Engel Jef Costello verwandt zu sein. Wie dieser trägt der Franzose Francis (Johnny Hallyday) einen Trenchcoat und ist alles andere als ein geborener Alleinunterhalter.
Im Gegensatz zu vielen Kollegen hat Johnnie To dem sicherlich vorhandenen Ruf Hollywoods weitgehend widerstanden. Seine Filme seien untrennbar mit Hongkong verbunden, hat er in Interviews geäußert. Wohl deshalb wurde der Handlungsort des nun auf Eis liegenden Remakes des Melville-Klassikers “Le Cercle Rouge” in seine Heimatstadt verlegt. Mehrere Jahre lang wurden Liam Neeson und Orlando Bloom mit diesem Projekt in Verbindung gebracht, doch 2009 verkündete To in Cannes, dass wohl nichts aus diesem Traum werden würde. Den vermeintlichen Ersatz desselben stellte er damals vor, eine chinesisch-französische Koproduktion mit dem Namen Vengeance. Man kann To sicher nicht vorhalten, dass er immer nur den selben Film dreht. Vielmehr jongliert er eine Reihe von Serien mit jeweils unterschiedlichen thematischen und strukturellen Eigenheiten. Da sind diverse Filme mit psychisch/physisch kranken Helden, den “Fulltime Killers” und “Mad Detectives” seiner Filmografie. Dem gegenüber steht u.a. die Hitmen-Trilogie, welche 1999 mit “The Mission” in Gang gesetzt, 2006 in Gestalt von “Exiled” wiederbelebt wurde. Im Gepäck eine begrenzte Zahl visueller und narrativer Topoi, nähert sich To diesen Filmen wie einem spaßigen Genrespielplatz an. Ob ironische Entblößung der Heroic Bloodshed-Klischees durch die Inszenierung des absoluten Gegenteils derselben in “The Mission” oder Adaption und Perfektion dieser im Nachfolger, die Filme zeigen To von seiner selbstreflexivsten Seite. Nur so wird aus einem Actionfilm aus HK ein Italo-Western in asiatischem Gewand. Oder eine blutige Hommage an Jean-Pierre Melville. Als solche kann man “Vengeance” zweifellos bezeichnen. Kein Wunder, dass ursprünglich Alain Delon für die Hauptrolle vorgehesen war. Die trägt den Namen Francis Costello und scheint entfernt mit dem eiskalten Engel Jef Costello verwandt zu sein. Wie dieser trägt der Franzose Francis (Johnny Hallyday) einen Trenchcoat und ist alles andere als ein geborener Alleinunterhalter.
Costello reist nach Hongkong, um Rache zu nehmen an den Mördern der Familie seiner Tochter. Ein einfaches “venge-moi” der schwer verletzten Überlebenden (Sylvie Testud) genügt. Durch einen Zufall erlangt er die Hilfe von drei Triadenkillern (Anthony Wong, Lam Ka-Tung und Lam Suet), die ihm fortan bedingungslos zur Seite stehen. Wie in den beiden anderen Hitmen-Filmen auch wird eine Gruppe neu zusammengesetzt, um dann Bewährungsproben im Kugelhagel zu bestehen. Wieder findet man einen durchgedrehten Simon Yam auf der Gegenseite. Doch während die Vorgänger dank ihres spontanen Produktionsprozesses (kein Drehbuch, unter 20 Tagen Drehzeit) mit absoluter Reduktion auf das Wesentliche punkteten, ist der Plot von “Vengeance” geradezu aufgeplustert. Zumindest für einen film von To. Das Drehbuch von Milkyway-Mitbegründer Wai Ka-Fai synthetisiert aus Hitman-Filmen und kranker Heldenfigur eine unausgeglichene Genre-Dekonstruktion. Costello verliert nämlich nach und nach sein Gedächtnis. Eine alte Kugel im Kopf trägt die Schuld daran, dass er schon bald nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheiden kann, geschweige denn weiß, warum er in Hongkong ist. Während einer Schießerei ist das alles andere als beruhigend und davon bietet To genügend, um über einige Durststrecken hinweg zu trösten.
“Vengeance” ist schließlich keineswegs ein runder Film. Waren “Exiled” und zuletzt “Sparrow” visuelle und musikalische Leckerbissen, deren Leichtigkeit einen Meister auf dem Höhepunkt seiner Kunst zeigte, ist “Vengeance” unrhythmisch. Vielleicht ist der Grund für diesen Makel darin zu finden, dass die Gruppe hier niemelas wirklich fehlerfrei funktioniert, dass Hallyday immer ein Fremdkörper bleibt, was weniger an ihm selbst liegt, als an der Schwäche, die ihm das Drehbuch aufbürdet. Die ein oder andere massiv deplatzierte Szene, welche deutlich Wai Ka-Fais Handschrift trägt, entschuldigt das nicht. Dazwischen: Ungewöhnlich viel stille, viel tote Zeit wie einst bei Melville, die von (zu) kurzen Musikausbrüchen unterbrochen wird, wenn die Waffen im Einsatz sind. Da werden dann die filmischen Mittel des Genres auf eine Weise in Erinnerung gerufen, die jedem Genuss im Weg steht. Die Selbstreflexivität, welche (hoffentlich) dahinter steht, distanziert, nimmt den Spaß, verbannt auf den Posten reiner Bewunderung aus der Ferne.
Eine an einen Endzeitfilm erinnernde Schießerei zwischen Müllwürfeln wird Gesprächsstoff liefern, doch wirklich groß ist nur eine Sequenz im Wald. Unter dem flimmernden Licht des Mondes jagen da zwei Gruppen von Killern einander, während Laub auf sie nieder sinkt, gefolgt von sporadischer Dunkelheit, will es eine Wolke so. Hier findet To zu seiner Perfektion. Die Gewalt verblasst, die Schießerei wird zum Tanz, hin- und hergerissen von Stillstand und Bewegung, Licht und Schatten, Realität und Traum. Diese Minuten sind nicht nur unglaublich schön, sie konzentrieren auch die Essenz eines Films in sich, der von zahlreichen Spiegelungen gezeichnet ist. Wieder stehen Hitmen mit einer Mission im Mittelpunkt, doch ein Drehbuch-Coup schenkt ihnen,wie schon in “The Mission” Doppelgänger auf der Gegenseite. Ihr eigener Boss (Yam) hatte nämlich den Auftrag zur Ermordung der Familie erteilt, nur eben – der Zufall will es so – an drei andere Kollegen. So problemlos sich “Vengeance” als Weiterentwicklung zu den beiden anderen Hitmen-Filmen gesellt, so enttäuschend ist am Ende das Resultat. Die Pinselstriche von Johnnie To und Wai Ka-Fai stehen hier einander im Weg, passen ganz einfach nicht zusammen. So ist “Vengeance” ein qualitatives Auf und Ab, dessen Einzelteile überzeugender sind, als der Gesamteindruck.