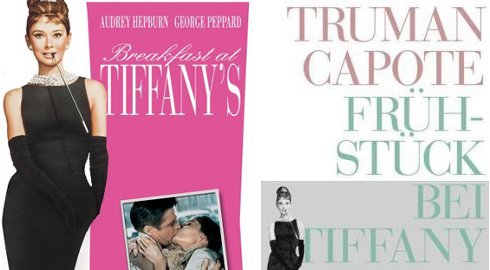Nebraska ist einer der größten Erzeuger landwirtschaftlicher Produkte in den USA. Das brachte dem Bundesstaat im Mittleren Westen den Beinamen “Cornhusker State” ein. Ob Stephen King beim Schreiben seiner Kurzgeschichte Children of the Corn aus dem Jahre 1977 bei dem seltsamen Eigenleben eines Maisfelds bereits an genmanipuliertes Getreide dachte, ist unwahrscheinlich. Eher kann man seine Kurzgeschichte als Seitenhieb auf religiösen Fundamentalismus in ruralen Gebieten verstehen – und auf aufsässige Bälger innerhalb einer absurden Jugendkultur, die allen Erwachsenen mit Sicheln und Sensen den Kampf ansagt. Hier eine kleine und willkürliche Rückschau.
 Kinder des Zorns (USA 1984)
Kinder des Zorns (USA 1984)
In dem Auftakt der inzwischen sieben Teile umfassenden Slasher-Reihe fragwürdiger Qualität verschlägt es Arzt Burt (Peter Horton) und Frau Vicky (Linda „Terminator-Braut“ Hamilton) ins ausgestorbene Kaff Gatlin, nachdem sie auf der Landstraße einen Jungen angefahren haben. Sämtliche Erwachsene wurden von der Terrorclique vom Maisfeld unter der Führung des Kind-Predigers Isaac (John Franklin) umgebracht, im Namen eines Gottes mit der umständlichen Bezeichnung „Er, der hinter den Reihen schreitet“. Die ländliche Apokalypse äußert sich zu psychedelischen Kindergesang auf der Tonspur atmosphärisch dicht in einer Geisterstadt, deren Häuser durch Chaos und Mais verwüstet wurden. Immerhin mit einem temporeichen Finale, subtilen Tötungsszenen (Kamera zeigt meist nur die Konsequenz, nicht die Tat selbst) und zahlreichen beklemmenden Point Of View-Shots gesegnet, kommt über weite Teilen Spannung auf. Das macht das alberne Okkult-Happening im Maisfeld ebenso vergessen wie die unfreiwillig dummen Ersatzpaps-Kind-Dialoge am Ende (“Ist er tot?” – “Ich glaub‘: ja.” – “Warum laufen wir dann immer noch weg?” – “Frag nicht. Weiter!”). John Franklin kehrt übrigens im unsäglichen sechsten Teil wieder, wie der deutsche Untertitel “Isaacs Rückkehr” schon androht.
 Kinder des Zorns III – Das Chicago-Massaker (USA 1995)
Kinder des Zorns III – Das Chicago-Massaker (USA 1995)
Eine betont ambitionierte Inszenierung mit einer zoomenden Handkamera, ein paar Szenen mit gefaketer, hoher Schärfentiefe und Gelbblenden bei Flashbacks täuschen nicht darüber hinweg, dass a) James D.R. Hickox ein noch beschissenerer Regisseur ist als sein ebenfalls im B-Horror tätiger Bruder Anthony (Warlock – The Armageddon und Hellraiser III sind… naja, jedenfalls keine Genrehighlights) und b) dieser einfältige Nachklapp nur Trashfans erfreuen wird. Dieses Mal ist Eli (nervig wie ein quengelndes Kind: Daniel Cerny) der aufsässige Priester-Knilch, der nicht im beschaulichen Gatlin, sondern im Sündenpfuhl Chicago die gottlosen Highschoolkids um sich schart und den Erwachsenen oder anderen Ungläubigen nach dem Leben trachtet. Mordlüsterne Vogelscheuchen, ein herausgerissenes Rückgrat oder das alberne Finale mit einem schlecht getricksten Gummimonster, das im Maisfeld Puppen verschlingt, sind die unfreiwillig komischen Highlights, die im letzten Drittel dieses überkonstruierten Blödsinns die Langeweile ablösen. Sekundenkurz ist übrigens die junge Charlize Theron in einer Statistenrolle zu sehen, die von einem Maismonstertentakel penetriert wird. Einzig die Vorfreude auf diese Mini-Szene rechtfertigt das Quälen durch 80 Minuten bedeutungsschwangere Horror-Klischeesülze, die mit einem idiotischen Cliffhanger zusätzlich verärgert.
 Kinder des Zorns IV – Mörderischer Kult (USA 1996)
Kinder des Zorns IV – Mörderischer Kult (USA 1996)
War Linda Hamilton im ersten Teil eine zumindest interessante Personalie, so gilt das hier für die unglaubwürdige, da viel zu nette Naomi Watts. Ein Jahr nach ihrem Auftritt in Tank Girl und fünf Jahre vor David Lynchs Mulholland Drive spielt sie eine Medizinstudentin, die in ihre ländliche Heimatstadt zurückkehrt und hinter das Geheimnis eines wieder auferstandenen Kinderpriesters kommt. Nachdem alle Kinder des Örtchens gleichzeitig ein merkwürdiges Fieber bekommen und sich die garstigen Dreikäsehochs biblische Namen geben, schreitet sie mit Waffengewalt zur Tat. Neben kurzen Schock-Inserts als Unart des Genrefilms in den 90er Jahren bleiben einzig ein paar hübsche Totalen der aufgehenden oder untergehenden Sonne überm Maisfeld im Gedächtnis haften. Abseits einiger durchaus gelungener Gore-Szenen regiert über weite Strecken das Geschwafel um wiederkehrende Geister und die Einfallslosigkeit, die sich insbesondere in einem vergurkten Finale äußert.