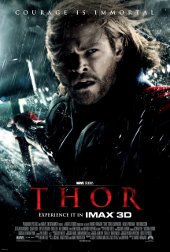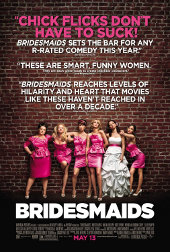 Fünf Frauen essen Lammspieße, gehen hinterher zu einer Anprobe und haben dabei mächtige Verdauungsprobleme. Was für ein brillanter und äußerst innovativer Gag das ist. Obwohl Bridesmaids immer wieder gefährlich nah am Erniedrigungshumor eines Bridget Jones-Films vorbei streift, ist Drehbuch-Co-Autorin und Hauptdarstellerin Kristen Wiig zusammen mit Regisseur Paul Feig eine außerordentlich positive Überraschung von einem Film gelungen. Ein klassisches Motiv des Genres aufgreifend, gräbt sich die Komödie mit dem dümmlichen und fehlleitenden deutschen Titel “Brautalarm” tief in die Funktionsmechanismen von Freundschaften, kommt am Ende heraus und feiert die Selbstverwirklichung. Um Frauen geht es übrigens auch. Deswegen wurde “Bridesmaids” im Vorfeld als “Hangover für Frauen” bezeichnet und in gewisser Weise stimmt das auch. Nur ist “Bridesmaids” wesentlich lustiger und weniger infantil. Wie der Hit von Todd Phillips, der derzeit seine zweite Ausgabe in den Kinos zur Schau trägt, konstruieren Feig und Wiig eine Gruppe aus Archetypen, setzen diese in einen Versuchsraum (Verlobungsparty, Restaurant, Flugzeug…) aus, um zu sehen, was dabei herauskommt. Doch wohingegen “Hangover” auf schnellen Staccato-Witzen aufbaute (Ein Tiger! Ein Baby! Mike Tyson!), lebt Bridesmaids von einem Comedy-Know How, das seit Jahrzehnten funktioniert. Statt den Zuschauer mit einer Überwältigungstaktik abzustumpfen, die ihn mit so vielen Pointen bewirft, dass eine irgendwann treffen muss, lebt diese “Frauenkomödie” vom behutsamen Aufbau.
Fünf Frauen essen Lammspieße, gehen hinterher zu einer Anprobe und haben dabei mächtige Verdauungsprobleme. Was für ein brillanter und äußerst innovativer Gag das ist. Obwohl Bridesmaids immer wieder gefährlich nah am Erniedrigungshumor eines Bridget Jones-Films vorbei streift, ist Drehbuch-Co-Autorin und Hauptdarstellerin Kristen Wiig zusammen mit Regisseur Paul Feig eine außerordentlich positive Überraschung von einem Film gelungen. Ein klassisches Motiv des Genres aufgreifend, gräbt sich die Komödie mit dem dümmlichen und fehlleitenden deutschen Titel “Brautalarm” tief in die Funktionsmechanismen von Freundschaften, kommt am Ende heraus und feiert die Selbstverwirklichung. Um Frauen geht es übrigens auch. Deswegen wurde “Bridesmaids” im Vorfeld als “Hangover für Frauen” bezeichnet und in gewisser Weise stimmt das auch. Nur ist “Bridesmaids” wesentlich lustiger und weniger infantil. Wie der Hit von Todd Phillips, der derzeit seine zweite Ausgabe in den Kinos zur Schau trägt, konstruieren Feig und Wiig eine Gruppe aus Archetypen, setzen diese in einen Versuchsraum (Verlobungsparty, Restaurant, Flugzeug…) aus, um zu sehen, was dabei herauskommt. Doch wohingegen “Hangover” auf schnellen Staccato-Witzen aufbaute (Ein Tiger! Ein Baby! Mike Tyson!), lebt Bridesmaids von einem Comedy-Know How, das seit Jahrzehnten funktioniert. Statt den Zuschauer mit einer Überwältigungstaktik abzustumpfen, die ihn mit so vielen Pointen bewirft, dass eine irgendwann treffen muss, lebt diese “Frauenkomödie” vom behutsamen Aufbau.
Zurück zu den Lammspießen. Eigentlich beginnt alles in einem Restaurant, in dem sich die fünf Brautjungfern mit der werdenden Braut (Maya Rudolph) treffen. Hier brodeln die Konflikte auf, insbesondere der zwischen Annie (Kristen Wiig) und Helen (Rose Byrne), die beide um die Freundschaft der Braut wetteifern, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Weiter geht’s von Annies äußerlich heruntergekommener Restaurant-Empfehlung zu Helens Lieblings-Edel-Brautmodenladen. Dort nimmt das Unheil der Lammspieße seinen Lauf. Allerdings kommt hier das Drehbuch ins Spiel, denn die Kamera wird nicht einfach nur auf hysterisch herumschreiende Frauen gehalten, die dringend einen Abort benötigen. Natürlich werden diese money shots ebenfalls gezeigt, wir haben hier schließlich eine R-Rated Comedy vor uns, die von Judd Apatow produziert wurde. Dass die Szene funktioniert, ist dagegen auf den scheinbar simpelsten aller Bausteine zurückzuführen: der Figurendynamik. Die schnöselig perfekte Helen hat als einzige nicht vom Fleisch gegessen. Nun steht sie, während rundherum das Chaos ausbricht, der schwitzenden, sich windenden Annie gegenüber, die unbedingt ihre Würde als beste und älteste Freundin der Braut behalten will. Parallelmontage, Spannung – Entspannung, Stillstand – Bewegung und am Ende der große Knall, der sich nicht als das herausstellt, was man bei dieser Konstellation erwartet.
Die Lammspieß-Sequenz ist aber nur eines von vier oder fünf größeren set pieces, welche die Grundstruktur des Films vorgeben. Nicht alle sind gleichermaßen erfolgreich, aber allein der Flug nach Las Vegas sollte angehenden Drehbuchautoren als Unterrichtsmaterial dienen. Ein Setting (Flugzeug), ein paar sehr unterschiedliche, teils exzentrische Figuren, zwei Probleme (Flugangst, Rivalität). Das sind diesmal die Zutaten und heraus kommt ein weiterer größerer Baustein des eigentlichen Konflikts. Denn im Endergebnis werden in “Bridesmaids” nicht nur Sketche aneinandergereiht. Annies Traum von der beruflichen Selbstverwirklichung, der nach der Wirtschaftskrise genauso wie ihr Privatleben in Scherben liegt, fungiert als dramaturgischer Kitt. Nun fürchtet sie, ihre beste Freundin zu verlieren. Solchermaßen basal und effektiv sind die Antriebskräfte der Komödie. Als deren größte Stärke stellt sich abseits ihres Aufbaus sowie der Darsteller (hervorgehoben sei Melissa McCarthy) ihr Mut zum Erwachsensein heraus. Nicht auf popkulturellen Witzchen wird herumgeritten. Die enervierende Geekverherrlichung zeitgenössischer amerikanischer Genrevertreter bleibt ebenfalls außen vor und zur Abwechslung thematisiert Bridesmaids auch nicht das inhärente Doofsein des Erwachsenwerdens, sondern schlicht und einfach das Weitermachen nach einem Rückschlag. Mit dem propagierten feministischen Manifesto haben wir es hier nicht zu tun, sondern mit einer guten amerikanischen Komödie, die dem weiblichen Personal ausnahmsweise den Objektstatus verwehrt. Bitte mehr davon.
Zum Weiterlesen:
Überblick über die Kritiken bei Film-Zeit.de.