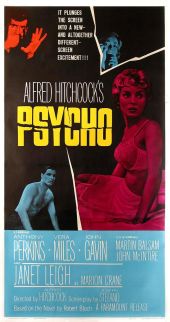„Hundert Jahre habe ich nichts Ähnliches gesehen“, hat Picasso über Die Kraniche ziehen gesagt. Nicht weniger enthusiastisch äußerte sich Martin Scorsese über Soy Cuba: “Dieser Film stellt alles in den Schatten, was wir heute machen.” Trotzdem sind beide filmgeschichtlich nicht gerade mit Lorbeeren überhäuft worden. Bekam der erste immerhin noch die Goldene Palme in Cannes 1958, war “Soy Cuba” bis zum Ende der Sowjetunion fast unbekannt. An der Kameraarbeit kann es nicht liegen, denn Sergei Urussewskis Klasse wird gerade in diesen beiden Filmen sichtbar. Das Problem ist, dass diese beiden Filme als Propagandafilme wahrgenommen werden. Bei “Die Kraniche ziehen” kann man es am deutlichsten erkennen. Während der Tauwetterphase nach Stalins Tod entstanden, wird meist lobend erwähnt, dass er eine geringere politische Lehrhaftigkeit gegenüber den vorherigen Filmproduktionen besitzt. Was aber zugleich heißt, dass er diese noch hat. Er ist das geringere Übel, das zwar durch die Arbeit von Regisseur Michail Kalatosow und eben Kameramann Urussewski beeindruckt, aber immer noch das Stigma der Lüge und der Manipulation(-sversuche) trägt. Doch schauen wir uns die Filme an. Wird dieses Urteil ihnen gerecht?
„Hundert Jahre habe ich nichts Ähnliches gesehen“, hat Picasso über Die Kraniche ziehen gesagt. Nicht weniger enthusiastisch äußerte sich Martin Scorsese über Soy Cuba: “Dieser Film stellt alles in den Schatten, was wir heute machen.” Trotzdem sind beide filmgeschichtlich nicht gerade mit Lorbeeren überhäuft worden. Bekam der erste immerhin noch die Goldene Palme in Cannes 1958, war “Soy Cuba” bis zum Ende der Sowjetunion fast unbekannt. An der Kameraarbeit kann es nicht liegen, denn Sergei Urussewskis Klasse wird gerade in diesen beiden Filmen sichtbar. Das Problem ist, dass diese beiden Filme als Propagandafilme wahrgenommen werden. Bei “Die Kraniche ziehen” kann man es am deutlichsten erkennen. Während der Tauwetterphase nach Stalins Tod entstanden, wird meist lobend erwähnt, dass er eine geringere politische Lehrhaftigkeit gegenüber den vorherigen Filmproduktionen besitzt. Was aber zugleich heißt, dass er diese noch hat. Er ist das geringere Übel, das zwar durch die Arbeit von Regisseur Michail Kalatosow und eben Kameramann Urussewski beeindruckt, aber immer noch das Stigma der Lüge und der Manipulation(-sversuche) trägt. Doch schauen wir uns die Filme an. Wird dieses Urteil ihnen gerecht?
 Die Kraniche ziehen handelt von Weronika, einem jungen Mädchen, das verliebt und glücklich ist. Doch die Kraniche ziehen über Moskau und der Zweite Weltkrieg bricht aus. Ihr Geliebter Boris zieht freiwillig in den Krieg, während sie in Moskau bleibt. Und genau an diesem Punkt beginnt der Film, die Dimension zu zeigen, die Picasso den Atem raubte. Die Kamera beobachtet nicht, sie dringt tief in Weronika und Boris ein. Sie zeigt dem Zuschauer nichts, sondern lässt ihn am eigenen Leib spüren. Das Bombardement Moskaus, während dessen Boris‘ Bruder Weronika seine Liebe gesteht, ist wie ein wild zuckendes expressionistisches Gemälde. Angst und Verzweiflung sind mit der Hand zu fassen. Weronika entscheidet sich, den Bruder zu heiraten. Nach dem Gesehenen… Gefühlten, ist es nur zu verständlich, dass sie nicht allein sein möchte. Doch der Film geht weiter und sie erlebt im Krieg eine Welt, in der sie jeden Halt verliert. Wilde, zerhackte Bilder am Höhepunkt des Filmes entziehen auch dem Zuschauer das Gefühl von Sicherheit. Der Terror des Krieges auf den Einzelnen und besonders die Verzweiflung Weronikas werden in atemberaubende Bilder gepackt, die einen die Schicksalsschläge im eigenen Nacken fühlen lassen.
Die Kraniche ziehen handelt von Weronika, einem jungen Mädchen, das verliebt und glücklich ist. Doch die Kraniche ziehen über Moskau und der Zweite Weltkrieg bricht aus. Ihr Geliebter Boris zieht freiwillig in den Krieg, während sie in Moskau bleibt. Und genau an diesem Punkt beginnt der Film, die Dimension zu zeigen, die Picasso den Atem raubte. Die Kamera beobachtet nicht, sie dringt tief in Weronika und Boris ein. Sie zeigt dem Zuschauer nichts, sondern lässt ihn am eigenen Leib spüren. Das Bombardement Moskaus, während dessen Boris‘ Bruder Weronika seine Liebe gesteht, ist wie ein wild zuckendes expressionistisches Gemälde. Angst und Verzweiflung sind mit der Hand zu fassen. Weronika entscheidet sich, den Bruder zu heiraten. Nach dem Gesehenen… Gefühlten, ist es nur zu verständlich, dass sie nicht allein sein möchte. Doch der Film geht weiter und sie erlebt im Krieg eine Welt, in der sie jeden Halt verliert. Wilde, zerhackte Bilder am Höhepunkt des Filmes entziehen auch dem Zuschauer das Gefühl von Sicherheit. Der Terror des Krieges auf den Einzelnen und besonders die Verzweiflung Weronikas werden in atemberaubende Bilder gepackt, die einen die Schicksalsschläge im eigenen Nacken fühlen lassen.
Weronika entzieht sich so einer Symbolhaftigkeit, die für Propaganda notwendig ist. Die poetische Kraft der Kamera macht sie zu einem Individuum. Einem Individuum, welches nichts verdeutlicht, sondern den Zuschauer erfahren lässt. Wenn sie am Ende Boris‘ Tod dadurch überwindet, dass sie den heimkehrenden Soldaten die Blumen schenkt, die für ihren Geliebten bestimmt waren oder Hoffnung fühlt durch die Rede eines Soldaten, in der dieser vom angebrochenen Weg in eine bessere Welt kündet, in der täglich gegen den Faschismus und die Unterdrückung gekämpft wird, dann lässt sich Weronika zwar von Propagandaslogans berühren, aber nicht verführen. Nach dem Durchgestanden braucht sie Hoffnung zum Leben und während der an allen Enden zu spürenden Erleichterung hofft sie auch das Unmögliche, nämlich die Sowjetpropaganda. So ziehen am Ende des Films wieder die Kraniche über Moskau, der Krieg ist vorbei. Aber Kraniche kommen wieder.
 Soy Cuba funktioniert auf ähnliche Weise, auch wenn das Problem der Propaganda hier etwas komplizierter ist. In vier Episoden wird die Zeit der kubanischen Revolution eingefangen. Ein amerikanischer Freier möchte aus Neugier eine Nacht bei einer Hure zu Hause verbringen und landet in einem elenden Slum. Ein Bauer verliert allen Mut, als er von seinem Pächter erfährt, dass sein Land verkauft wurde und er verschwinden muss. Ein Student möchte einen korrupten Polizisten umbringen, bringt es aber nicht übers Herz, nur um kurz darauf zu sehen, wie eben dieser Polizist einen seiner Freunde umbringt. Ein Bauer verliert einen Sohn im Bombenhagel, den die Armee über seinem Land im Kampf gegen Fidel Castros Rebellen abwirft.
Soy Cuba funktioniert auf ähnliche Weise, auch wenn das Problem der Propaganda hier etwas komplizierter ist. In vier Episoden wird die Zeit der kubanischen Revolution eingefangen. Ein amerikanischer Freier möchte aus Neugier eine Nacht bei einer Hure zu Hause verbringen und landet in einem elenden Slum. Ein Bauer verliert allen Mut, als er von seinem Pächter erfährt, dass sein Land verkauft wurde und er verschwinden muss. Ein Student möchte einen korrupten Polizisten umbringen, bringt es aber nicht übers Herz, nur um kurz darauf zu sehen, wie eben dieser Polizist einen seiner Freunde umbringt. Ein Bauer verliert einen Sohn im Bombenhagel, den die Armee über seinem Land im Kampf gegen Fidel Castros Rebellen abwirft.
Auch hier ist es die Kamera, die den Zuschauer eine Welt erfahren lässt, die nach Veränderung schreit. Alles scheint aus der Bahn geworfen. Gesichter sind meist schief im Bild. In entrückten Kamerafahrten durch den Rauch und die Düsternis der Casinos verliert der Zuschauer jedes Gefühl für den Raum. Die Realität löst sich auf. Eine manische, zuckende, schreiende Kamera zeigt nicht wie der Bauer aus der zweiten Episode wütend mit einer Machete auf seine Ernte einschlägt… sie beobachtet nicht, sie lässt die Verzweiflung, die tiefe, hoffnungslose Verzweiflung in jedes Bild fließen.
In wunderschönen Bildern wird eine paradiesische Insel gezeigt, deren Palmen und Pflanzen in einem unirdischen Weiß scheinen… einem goldenem Schein, der in seiner blendenden Schönheit den Großteil der Bewohner verhöhnt. So zeigt der Film das riesige Ausmaß des kubanischen Leides und damit, dass man Revolutionen nicht einfach auslösen kann, sondern das Leid nötig ist, ein riesiges, unerträgliches Leid, das man vorher nicht kannte. Wenn am Ende die Menschen lieber für das Vaterland sterben, als in Unfreiheit zu sterben, wie sie singen, dann wollen sie im Grunde Hoffnung für ihr Leben. Einen Grund nicht zu sterben. So folgen sie auch revolutionären Idealisten, die ihnen den Himmel auf Erden versprechen. Der Film endet folglich auch mit der Revolution, denn er ist zu keiner Zeit ein Film pro Fidel Castro oder den Kommunismus, sondern ein Film über Leid und Hoffnung. Er zeigt die Freude des Sieges und belässt es dabei, denn vielleicht liegt in der Freude auch schon wieder der Hohn der Zukunft.