Anthony Wong Chau-Sang, inoffizieller König der Category III-Filme und in unseren Breitengraden bekannt durch seine Rolle des Inspektor Wong in der Infernal Affairs Trilogie [ich sage nur: “Autodach”], ist der Hauptgrund, warum ich mir die zwei sehr unterschiedlichen Filme The Untold Story (1993) und Colour of the Truth (2003) angeschaut habe.
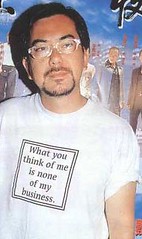 Wong, neben Lau Ching-Wan und Francis Ng einer der wichtigsten Charakterdarsteller Hongkongs, gilt als bad boy der Industrie. Ob er nun bei den HK Film Awards im Freddy Krueger-Kostüm auftaucht; erklärt, er werde seinen Award mit aufs Klo nehmen oder über das nicht vorhandene Talent seiner Kollegen herzieht, er hegt und pflegt seinen Status als enfant terrible. Seine legendären Interviews variieren zwischen genervt einsilbig und zutiefst sarkastisch.
Wong, neben Lau Ching-Wan und Francis Ng einer der wichtigsten Charakterdarsteller Hongkongs, gilt als bad boy der Industrie. Ob er nun bei den HK Film Awards im Freddy Krueger-Kostüm auftaucht; erklärt, er werde seinen Award mit aufs Klo nehmen oder über das nicht vorhandene Talent seiner Kollegen herzieht, er hegt und pflegt seinen Status als enfant terrible. Seine legendären Interviews variieren zwischen genervt einsilbig und zutiefst sarkastisch.
An Kritik für seine heimische Filmwirtschaft und die eigenen Werke spart er nie. Wem das “Wir waren am Set eine große Familie“-Gesülze nervt, sollte sich mal zu Gemüte führen, was der vielfach ausgezeichnete Wong über Größen wie John Woo oder Tsui Hark zu sagen hat.
An mehr als 140 Filmen hat der 46 Jährige mittlerweile mitgewirkt. Offenkundiger Müll, wie Gen-Y-Cops, findet sich ebenso in seiner Filmografie, wie Arthousekost von Ann Hui. Diese Vielfalt spiegelt sich auch in seinem Rollenrepertoire wieder.
Berühmt geworden durch wahnsinnige Mörder (The Untold Story, Ebola Syndrome) und gewissenlose Gangster (Hard Boiled), kann er den unauffälligen Normalo, der zum Berserker wird (Taxi Hunter, Beast Cops) ebenso glaubwürdig verkörpern, wie sympathische Vater- und Mentorfiguren (Infernal Affairs, Princess-D).
10 Jahre liegen zwischen The Untold Story und Colour of the Truth, die Unterschiede könnten kaum größer sein. Die bloße Präsenz dieser beiden Filme erzählt uns einiges über die Geschichte des Hongkong-Kinos.
The Untold Story (HK 1993)
Bei uns nennt man es FSK-18, in den USA NC-17, in Hongkong heißt es seit 1988 Category III, oder besser Cat. III. In anderen Ländern führt die Altersfreigabe “ab 18” dazu, dass die Filmemacher versuchen dieses Etikett durch Schnitte zu vermeiden. Selbst ein Gewaltporno wie Saw IV (den ich gestern im Kino durchlebt habe) wurde aus kommerziellen Gründen so geschnitten, dass er nur ein R-Rating bekommen hat.
In Hongkong führte die Klassifizierung dazu, dass Produzenten begannen, bewusst das “Label” Cat. III bis zum äußersten auszureizen. Wieviel Gewalt, Sex oder Gewalt und Sex kann man zeigen, bevor die Zensur einschreitet? Für wenige Jahre entwickelte sich so ein Genre, dessen Existenzberechtigung vielleicht fraglich, dessen Trashfaktor dafür erfreulich hoch ist. Viel Geld stand nie zur Verfügung. Warum auch, ging es doch vordergründig nur darum, für Freunde des schlechten Geschmacks möglichst viel Blut, Gedärm und nackte Haut in neunzig sinnfreie Minuten zu packen.
The Untold Story ist einer der Klassiker des Genres, was nicht nur an der extremen Natur des Films liegt. Der ein oder andere Zuschauer wird sich vielleicht hinterher wünschen, die titelgebende Geschichte wäre unerzählt geblieben.
Restaurantbesitzer Wong Chi-Hang (Anthony Wong) neigt dazu, seine köstlichen Fleischbällchen mit den Überresten ungeliebter Mitbürger zu füllen. Das ist auch kein Wunder, schließlich betrügt der Mann regelmäßig beim Mahjong. Einem solchen Menschen kann man alles zutrauen! Als die Polizei ihn festnimmt und ein Geständnis erpressen will, beginnt ein brutaler Foltermarathon.
Im Grunde hat Regisseur Herman Yau mit diesem überraschend logischen Schocker zwei verschiedene Filme gedreht, die zuerst parallel ablaufen und sich ab einem bestimmten Zeitpunkt zu einem Film vereinigen. Mit einem seltsamen Ergebnis.
Der eine Teil erzählt in dreckigen Farben die Geschichte eines Serienmörders, dessen Metzgertätigkeiten vor keiner Altersgruppe halt machen. Wong spielt diesen geldgierigen Misanthropen so abstoßend und widerwärtig, wie man es nur selten bei einer Hauptfigur sieht.
Andere Psychopathen der Filmgeschichte gewinnen die Herzen des Zuschauers durch ihre charismatische Intelligenz und Überlegenheit (Hannibal Lecter? John Doe? Jigsaw?). Wong Chi-Hang ist nicht besonders schlau, hat schlechte Umgangsformen und ist die Unfreundlichkeit in Person.
Er wäre schon abstoßend genug, wenn er keine Frauen vergewaltigen und Kinder ermorden würde. Auch verweigert der Film eine Erklärung für diesen abscheulichen Charakter. Nein, es wird keine von einer dominanten Mutter kontrollierte Kindheit gezeigt oder irgendeine Ideologie, irgendein höheres Ziel angegeben, für das er all die Schandtaten vollbringt. Er ist einfach nur da und wir müssen damit leben.
Anthony Wong hat für die intensive Darstellung seinen ersten Hongkong Film Award bekommen, damals ein Novum für einen Cat. III-Film. Mir persönlich gefallen seine späteren Rollen besser, da in The Untold Story wenig Platz für Subtilität und Zurückhaltung geboten wird.
Trotzdem könnte sich in diesem Erzählstrang das Potenzial für einen – trotz seiner unglaublichen Brutalität – guten Film verstecken, sozusagen als frischer Wind im Serienkillergenre. Ein Film der seinen Killer mal realistisch anpackt.
Wären da nicht die Cops, also der bereits erwähnte “zweite Film”. Danny Lee (The Killer) führt sie an als etwas fragwürdige Autoritätsfigur. Er bringt ständig Nutten mit aufs Revier. Seine Untergebenen sind nicht viel besser und vertreiben die meiste Zeit damit, ihre einzige Kollegin zu hänseln. Was hier zwischen den unfähigen Ermittlern abläuft, trägt in großen roten Lettern mit Ausrufezeichen den Titel COMIC RELIEF! vor sich her und es passt überhaupt nicht in diese Serienkillerstory, die höchstens schwarzen Humor aufblitzen lässt, aber nicht viel mehr.
So kann der Zuschauer nach blutigen Zerstückelungen hin und wieder befreit aufatmen. Die düstere Atmosphäre ist aber dahin. Diese beiden Stränge treffen nach der Gefangennahme des Mörders zusammen. Die hölzern agierenden Darsteller der Polizisten und der in der Story angelegte unbarmherzige Umgang mit Wong Chi-Hang, der mit dem auf Rache versessenen Bruder eines seiner Opfer eingesperrt wird, führen am Ende sogar dazu, dass wir Mitleid mit dem Widerling empfinden.
The Untold Story darf sich aufgrund der schauspielerischen Leistung des Hauptdarstellers und der technisch versierten Regie von Herman Yau als Höhepunkt seines Genres feiern. Seine disparate Natur verhindert aber, dass ein wirklich guter Film im DVD-Player landet. So bleibt am Ende eher der Trashfaktor, der zugegebenermaßen abgestumpfte Zuschauer – wie mich – sehr gut unterhalten kann.

Colour of the Truth (HK 2003)
Nach der Rückgabe Hongkongs an China wurde der Untergang des Kinos der Sonderverwaltungszone überall vorausgesagt. Die großen Regisseure waren ins Ausland gegangen (John Woo, Ringo Lam, nun auch Wong Kar-Wai), die Zensur machte dem Cat. III-Genre ein Ende und die Filme zielten von Jahr zu Jahr immer mehr auf den Markt Festlandchinas ab.
Man geht davon aus, dass Hongkongs Filmindustrie früher oder später mit der Chinas verschmelzen wird. Das sind traurige Gedanken angesichts der Tatsache, dass kaum ein wegweisender Film, ob Drama oder Krimi, in China überhaupt gezeigt werden darf. Sozusagen als Schlag für die dahinsiechende Filmindustrie muss noch festgehalten werden, dass die Ticketverkäufe und Filmproduktionen Hongkongs pro Jahr stetig zurück gehen.
Es ist also kein Wunder, wenn man dort gnadenlos bekannte Erfolgsrezepte kopiert. Infernal Affairs und seine Ableger waren ein unerwarteter Hit an den Kinokassen gewesen, d.h. früher oder später wurden Undercoverdramen und Triadenfilme en masse produziert, die vom Hype profitieren wollten.
Colour of the Truth geriet schnell in den Verdacht ein solcher Abkömmling zu sein, nicht zuletzt wegen seiner Besetzung. Bedenkt man, dass Wong Jing, der Albtraum aller geschmackvollen Kritiker, diesen Film in die Wege geleitet hat, kann man davon ausgehen, dass Colour of the Truth auch so gedacht war. Die Story ähnelt Infernal Affairs aber nicht wirklich:
Die beiden Cops Wong (Anthony Wong) und Seven Up (Lau Ching-Wan) stehen sich auf einem Dach gegenüber, als Wong den Triadenboss “Blind” Chui (Francis Ng) festnehmen will. Nach dem Ende der Konfrontation ist Wong der einzige Überlebende der Drei. 10 Jahre später kommt Neuling Cola (Raymond Wong) in die Einheit Wongs. Er ist der Sohn Seven Ups und will Rache am Mörder seines Vaters üben.
Den inszenatorischen Fähigkeiten des Co-Regisseurs Marco Mak ist es wohl zu verdanken, dass Colour of the Truth so gut geworden ist. Der stylische, in ausgebleichten Farben gehaltene Film ist temporeich und spannend, trotz der fehlenden Motivation der Hauptfigur; die Figur Wongs ist viel zu sympathisch, als dass wir glauben könnten, der junge Cop könne sie töten.
Anthony Wong möchte man zwar hin und wieder zuflüstern, er solle mal seine Sonnenbrille abnehmen, damit wir sein Spiel besser verfolgen können. Seine Fähigkeit, innerhalb weniger Filmminuten einen glaubwürdigen, vielschichtigen Charakter auf Zelluloid zu bannen, erbringt allerdings einen nicht zu unterschätzenden Mehrwert für den Thriller.
Trotz der Storymängel ist Colour of the Truth ein spannender Thriller, dessen Actionszenen nicht enttäuschen. Selbst die eher ruhigen Momente – so pflegt Wong in einer Szene seinen gelähmten Vater – überzeugen dank der Besetzung. Groß ist Colour of the Truth aber nur in der Auftaktsequenz, die den Rahmen des Films bildet: Lau Ching-Wan, Francis Ng, Anthony Wong auf einem Dach, das ist sehenswertes Kino!

Mehr zum Thema Cat. III.
Ein lesenswerter Artikel über die Karriere Anthony Wongs.
Kritiken zum Hongkong Kino, inkl. Infernal Affairs.


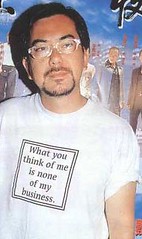 Wong, neben Lau Ching-Wan und Francis Ng einer der wichtigsten Charakterdarsteller Hongkongs, gilt als bad boy der Industrie. Ob er nun bei den HK Film Awards im Freddy Krueger-Kostüm auftaucht; erklärt, er werde seinen Award mit aufs Klo nehmen oder über das nicht vorhandene Talent seiner Kollegen herzieht, er hegt und pflegt seinen Status als enfant terrible. Seine
Wong, neben Lau Ching-Wan und Francis Ng einer der wichtigsten Charakterdarsteller Hongkongs, gilt als bad boy der Industrie. Ob er nun bei den HK Film Awards im Freddy Krueger-Kostüm auftaucht; erklärt, er werde seinen Award mit aufs Klo nehmen oder über das nicht vorhandene Talent seiner Kollegen herzieht, er hegt und pflegt seinen Status als enfant terrible. Seine 

