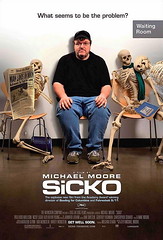“Images of broken light which dance across before me like a million eyes that call me on and on across the universe”

Queen-Musicals, Abba-Musicals, nun sogar ein Udo Jürgens-Musical in Hamburg. Hat man sich erstmal vor einer aufdringlichen TV-Werbeveranstaltung zum Thema in einer einsamen Ecke versteckt, da schleicht sich von hinten schon listenreich die nächste Nostalgieshow an.
Mit Nostalgie hat “Across the Universe” nicht viel zu tun, auch wenn die hier rekreierte Beatles-Ära ganz genau so aussieht, wie wir Nachgeborene sie uns in den Stunden der Ernüchterung über unsere Gegenwart vorstellen.
Julie Taymors Musical, das zur Abwechslung mal nicht auf einer uninspirierten Bühnenshow basiert, funktioniert im Grunde nach dem in Anlehnung an Rick Altmans Genre-Theorie formulierten Prinzip: “Boy meety girl, boy sings with girl, boy gets girl.”
Besagter Boy ist der britische Hafenarbeiter und Freizeitmaler Jude (Jim Sturgess), der sich in den 60ern nach Amerika einschifft, um zum ersten Mal seinen Vater zu treffen. In Princeton trifft er genau diesen und den abgedrehten Studenten Max (Joe Anderson), dessen Schwester wiederum das Girl mit Namen Lucy (Evan Rachel Wood) ist.
Zusammen geht’s ab ins Demo-geschüttelte New York. In der dortigen WG lernen sie die Sängerin Sadie kennen, eine wilde Mischung aus Led Zep-Sänger Robert Plant und Rockröhre Janis Joplin. Ihr Gitarristenfreund JoJo erinnert auch nicht zufälligerweise an Jimi Hendrix. “Across the Universe” ist vollgespickt mit Referenzen, die sich nicht nur auf die Beatleshistorie beschränken.
Beginnt der Film noch auf Seiten Lucys mit Songs aus der Frühphase der Beatles, um das geordnete Heim, dessen Fünfzigerjahre-Heile-Welt-Vorstellungen zu unterstreichen, geht’s spätestens in New York ernsthaft zu. Antikriegsdemos und Bürgerrechtsbewegung wechseln sich ab mit Drogentrips aufs Land zu Timothy Leary-ähnlichen Gurus. Natürlich wird alles sehr schnell ernst. Judes neutraler Künstlerstatus kollidiert mit dem politischen Engagement seiner Freundin, Max wird eingezogen, usw.
Die bereits erwähnten Referenzen dehnen sich auch auf die Besetzung aus. So steht auf einmal Joe Cocker an der Ecke und singt seine Interpretation von “With a little Help from my Friends”. Das ist noch akzeptabel, wenn auch ablenkend, schließlich hat der Mann all das miterlebt.
Kommt dann jedoch Doctor Robert alias Bono alias “das ist doch der bebrillte und bemützte Sänger von U2, die in den 80ern ihre besten Alben veröffentlicht haben” dazu und singt “I am the Walrus”, ist die Begründung seiner Anwesenheit im Film nicht nachvollziehbar und sein Auftritt hat nur noch den “Hey, das ist Bono!”-Effekt.
Sieht man davon ab, den Film wegen seiner Episodenhaftigkeit im Mittelteil (in dem auch Bono auftritt) zu verurteilen, hat man immer noch ein verdammt gutes Musical vor sich stehen. Das liegt einerseits an den Songs (“Was kann man da schon bei einem Beatles-Musical falsch machen?”, fragt die aufdringliche Fanstimme in meinem Kopf), andererseits am Einfallsreichtum des Films.
“Across the Universe” wird nur im seltensten Falle zur Nummernrevue (eben in diesem Drogenmittelteil). Im Endeffekt haben die Lieder alle ihre inhaltliche Funktion zu erfüllen. Am besten und emotional ergreifensten gelingt dies bei Strawberry Fields Forever, Happiness is a Warm Gun und With a little Help from my Friends. Lied und Story stehen in absolutem Einklang miteinander, das eine ergänzt das andere.
Die Visualisierungen der Gesangseinlagen sind allesamt berauschend, wenn auch das ein oder andere Mal unnötig überladen (Being for the Benefit of Mr. Kite, “gesungen” von Eddie Izzard). Allein die Darstellung der Musterung und des Vietnamkriegs, die zugleich, dank ihrer Universalität, ein Kommentar zur aktuellen politischen Situation sein muss, ist ein deutliches Beispiel für die erfreuliche, detailverliebte Fantasie, die sich nicht in Sentimentalitäten verliert.
Von der Ähnlichkeit Jim Sturgess’ zu Paul McCartney, über den Bus, der an die Magical Mystery Tour erinnert, bis zum Finale (ich sage nur “Dach!”) ist Across the Universe eine einzige Hymne auf das Schaffen der Beatles und gleichzeitig eine Verortung ihrer Kunst in deren angestammter Zeit. Die Geschichte von Jude und Lucy erzählt uns, warum die Musik der Fab Four am Ende eine solche Evolution unterlief.
Etwas mehr zeitgeschichtliche Konsequenz hätte man Julie Taymor am Ende gewünscht, doch wen interessiert’s… “Nothing’s gonna change my world/Nothing’s gonna change my world.”
Ein Ausschnitt aus “I want You (She’s so heavy)”:
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=C4YztnK2iKQ]
Wie wär’s jetzt mit einem Kinks-Musical?
Der Titel: “Come Dancing”.
Bitte!

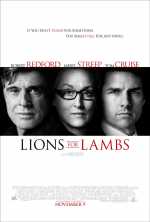 Auf drei Erzählebenen, die gleichzeitig und in Echtzeit ablaufen, diskutiert “Von Löwen und Lämmern” (Lions for Lambs) das außenpolitische Engagement der USA und die Rolle des einzelnen Staatsbürgers in der Ära des US-Interventionismus.
Auf drei Erzählebenen, die gleichzeitig und in Echtzeit ablaufen, diskutiert “Von Löwen und Lämmern” (Lions for Lambs) das außenpolitische Engagement der USA und die Rolle des einzelnen Staatsbürgers in der Ära des US-Interventionismus. Bedenkt man, dass Ben Stiller einer der komischsten Comedians Amerikas ist und einem gehypten Will Ferrel jederzeit die Schau stehlen könnte, ist seine Rollenwahl doch ziemlich mies. In letzter Zeit konzentriert er sich anscheinend nur noch darauf, “Ben Stiller” in seinen Filmen zu spielen. So auch in
Bedenkt man, dass Ben Stiller einer der komischsten Comedians Amerikas ist und einem gehypten Will Ferrel jederzeit die Schau stehlen könnte, ist seine Rollenwahl doch ziemlich mies. In letzter Zeit konzentriert er sich anscheinend nur noch darauf, “Ben Stiller” in seinen Filmen zu spielen. So auch in