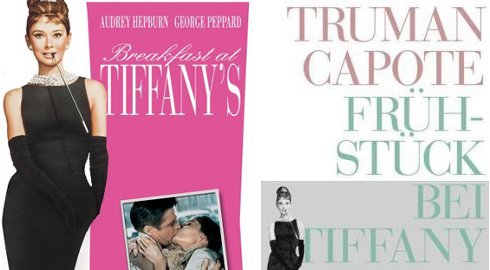Gesang und Tanz sind nicht die ersten Dinge, die gemeinhin mit der französischen Revolution verbunden werden. Doch Regisseur Peter Brook nimmt das Theaterstück Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats, dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn de Sade von Peter Weiss und lässt seine Schauspieler singen und tanzen. Ständig brechen Musicaleinlagen in die Handlung ein, wodurch sich die Atmosphäre zu einem beißenden Mitleiden des Zuschauers verdichtet. Musicals sind eruptive Freudentänze. Nicht hier. Denn nicht die Entmachtung der Adligen wird gefeiert, sondern die Hysterie der Figuren, welche immer wieder den Schrecken erleben, der den ständig enttäuschten Hoffnungen folgt.
 Wir schreiben den 13. Juli 1808. Napoleon ist Kaiser und auf dem Höhepunkt seiner Macht. Er hat Frankreich aus den Klauen einer vulgären Revolution befreit und es auf den Weg in ein aufgeklärtes Zeitalter geführt. So möchte es zumindest die offizielle, napoleonische Geschichtsschreibung. Um diese Aufgeklärtheit zu verdeutlichen soll der Marquis de Sade mit seinen Mitinsassen der Heilanstalt Charenton ein Theaterstück aufführen. Als Thema wählt dieser die Ermordung Jean Paul Marats, welcher während der Französischen Revolution als Vorsitzender der Jakobiner Partei und Herausgeber der Zeitschrift “L’ami de peuple” (Der Volksfreund) den Terror durch die Guillotine mit einleitete. An dieser Stelle … mit Start der Aufführung setzt der Film ein und wird die durch Gitter vom Publikum getrennte Bühne nie verlassen. Aus diesem scheinbaren Nachteil macht Brook aber seinen größten Vorteil. Nie verfällt er in die Beliebigkeit einer Theaterverfilmung, obwohl er tatsächlich nur die Aufführung auf einer Bühne abfilmt. Fast immer sind die Wände und Gitter im Bild zu sehen, doch der Ort verliert seinen kargen Realitätsgehalt und wird mit einer vollständigen Welt gefüllt. Einer Welt der Empörung, der Hoffnung und des Verfalls.
Wir schreiben den 13. Juli 1808. Napoleon ist Kaiser und auf dem Höhepunkt seiner Macht. Er hat Frankreich aus den Klauen einer vulgären Revolution befreit und es auf den Weg in ein aufgeklärtes Zeitalter geführt. So möchte es zumindest die offizielle, napoleonische Geschichtsschreibung. Um diese Aufgeklärtheit zu verdeutlichen soll der Marquis de Sade mit seinen Mitinsassen der Heilanstalt Charenton ein Theaterstück aufführen. Als Thema wählt dieser die Ermordung Jean Paul Marats, welcher während der Französischen Revolution als Vorsitzender der Jakobiner Partei und Herausgeber der Zeitschrift “L’ami de peuple” (Der Volksfreund) den Terror durch die Guillotine mit einleitete. An dieser Stelle … mit Start der Aufführung setzt der Film ein und wird die durch Gitter vom Publikum getrennte Bühne nie verlassen. Aus diesem scheinbaren Nachteil macht Brook aber seinen größten Vorteil. Nie verfällt er in die Beliebigkeit einer Theaterverfilmung, obwohl er tatsächlich nur die Aufführung auf einer Bühne abfilmt. Fast immer sind die Wände und Gitter im Bild zu sehen, doch der Ort verliert seinen kargen Realitätsgehalt und wird mit einer vollständigen Welt gefüllt. Einer Welt der Empörung, der Hoffnung und des Verfalls.
Fast schon spielerisch verbinden dabei die Autoren de Sade, Weiss und Brook die verschiedenen Ebenen von Charenton. Jede Minute der Handlung bezieht sich auf die Revolution, die Anstalt, die westliche Welt des Jahres 1967 sowie das hier und jetzt. Der Ruf der Figuren nach Freiheit kann nicht von dem Ruf der Insassen der Heilanstalt, welche sie verkörpern, getrennt werden. So fallen die Darsteller auch immer wieder aus der Rolle und schlafen ein oder werden von ihrem pathologischen Sexualtrieb übermannt. Die Trennung zwischen Rolle und Schauspieler verwischt nicht, sie hat nie bestanden. Bezeichnenderweise wird Marat, vom Verfolgungswahn gehetzt, von einem Paranoiker gespielt. Mit subversiven Witz und atemlosen Schrecken werden die Ebenen des Wahnsinns gebrochen und vereint. Die Frage nach der Gerechtigkeit der Welt stellt de Sade in die Kamera und meint damit die Zuschauer des Stücks und des Films. Niemand steht außen vor und genau daraus gewinnt The Persecution and Assassination of Jean-Paul Marat as Performed by the Inmates of the Asylum at Charenton Under the Direction of the Marquis de Sade seinen mitreißenden Sog.
Zentral auf besagter Bühne steht eine Wanne. In ihr sitzt der an Skrofulose leidende Marat. Er sieht sich von Verrätern der Revolution umgeben, von heimlichen Royalisten, welche die Revolution sabotieren möchten. Die einzige Möglichkeit zur Rettung stellt für ihn das Guillotinieren der Verdächtigen dar. Auf dass durch den Terror eine gerechte Welt ohne Hunger und Not entstehe. Doch die bluttriefende Realität ist uneingeschränkte Paranoia. So kommt die junge Charlotte Corday nach Paris, um Marat zu töten, die Macht der Jakobiner zu brechen und die blutigen Wogen der Revolution zu glätten. Dieser Handlungsstrang bleibt der Einzige, der in Raum und Zeit zu Verorten ist, denn die Darstellung der Revolution dient den beiden Regisseuren, de Sade und Brook, nur um sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob eine gerechte Welt mit entmenschlichter Gewalt erreichbar ist. Die Figuren schreien, weinen, zweifeln, disputieren manisch … alles miteinander und mit dem Publikum. Immer wieder fällt das Stück aus der Rolle. Zensoren unterbrechen, de Sade kürzt oder redet direkt mit dem Publikum. Eines bleibt klar: dass Gitter und Leinwand nur einen marginalen Schutz bieten. In der Arena von Charenton stehen sich somit der grausame Individualismus de Sades und der kollektiven Massenmord Marats gegenüber. Auf einer anderen Ebene sitzt Nietzsche über die kommunistische Utopie Lenins, Trotzkis und Stalins zu Gericht. Vielleicht ringt aber auch die Schönheit menschlicher Gewalt mit der Entmenschlichung dieser zu einem Werkzeug der Erreichung von grenzenloser Gleichheit.
Dass dies nicht zu einem verkopften Diskurs verkommt, ist ein kleines Wunder, erreicht durch Gesang und Tanz. Diese lockern nicht nur die Stimmung auf, sondern geben dem Ruf nach einer besseren Welt seinen perfekten Ausdruck, dem sich niemand entziehen kann. The Persecution and Assassination of Jean-Paul Marat… erschafft so ein Panoptikum der Wahnsinnigen und Hoffenden, die sich singend, tanzend und aus der Rolle fallend auf die Suche nach einer gerechten Welt begeben, die sie von Marats Wanne in Charenton aus zu erreichen hoffen. Ihnen zu folgen lohnt sich.
Dieser Text wurde bereits bei der Aktion Lieblingsfilm auf moviepilot.de veröffentlicht.